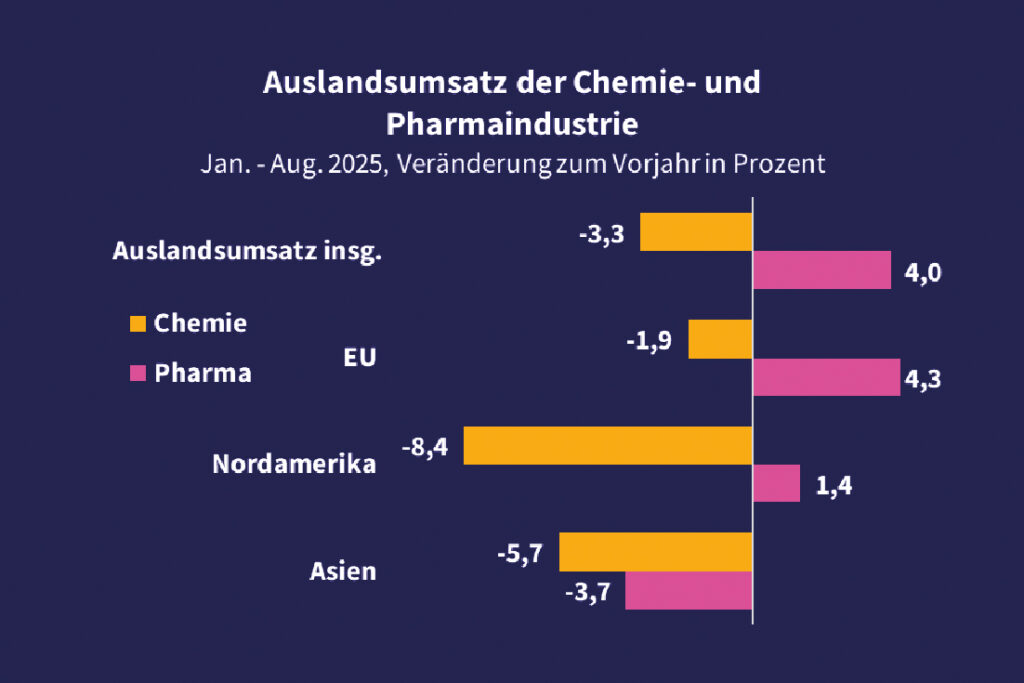Zwei aktuelle Studien des DIW Berlin Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e. V. untersuchen zentrale Herausforderungen der sozial-ökologischen Transformation. Der Fokus liegt auf den Verteilungswirkungen eines Klimagelds sowie auf dem Einfluss unternehmerischer Lobbyarbeit gegen Umweltschutz.
Klimageld: Linderung regionaler Ungleichgewichte ohne vollständige Entlastung
Angesichts steigender CO2-Preise – insbesondere durch den Übergang vom nationalen Brennstoffemissionshandel zum EU-Emissionshandelssystem ETS 2 ab 2027 – ergibt sich eine überproportionale Belastung für einkommensschwache Haushalte. Haushalte in ländlichen Regionen sind im Durchschnitt rund 60 % stärker betroffen als städtische.
Die DIW-Simulationen zeigen, dass ein einheitliches Pro-Kopf-Klimageld von 360 Euro pro Jahr zwar die regressiven Effekte teilweise ausgleicht, jedoch viele soziale Härtefälle bestehen bleiben. Insbesondere auf dem Land führen lange Arbeitswege, eingeschränkter ÖPNV, größere Wohnflächen und häufige Nutzung von Heizöl zu anhaltend hoher Belastung. Ein regional differenziertes Klimageld, abgestuft nach vier Siedlungsstrukturkategorien, reduziert diese Belastung auf dem Land leicht – senkt beispielsweise den Anteil stark belasteter Haushalte von 15,2 % auf 13,7 %. Gleichzeitig steigt dieser Anteil in städtischen Ballungsräumen von 9,2 % auf 11,7 %. Damit entsteht unter dem Strich kein zusätzlicher sozialpolitischer Vorteil.
Stefan Bach, Steuerexperte des DIW Berlin, sieht dennoch einen politischen Nutzen: Ein regional differenziertes Klimageld kann dem verbreiteten Widerstand gegen Klimapolitik in ländlichen Regionen entgegenwirken. Zur zielgerichteteren Entlastung empfiehlt das DIW Berlin eine Staffelung des Klimagelds nach Einkommen sowie die Nutzung finanzieller Spielräume für Investitionen in energetische Gebäudesanierung.
Unternehmen intensivieren Lobbyarbeit gegen Umweltpolitik bei steigender „grüner“ Nachfrage
Die zweite Studie beleuchtet die Reaktion von Unternehmen auf umweltbewusstere Konsumenten. Am Beispiel des US-Automobilsektors zeigt sich, dass Unternehmen ihre Lobbyaktivitäten gegen umweltfreundliche Regulierung verstärken, sobald sich die Nachfrage zugunsten nachhaltiger Produkte verschiebt. Besonders Unternehmen mit hohem Anteil an konventionellen Verbrennerfahrzeugen setzen vermehrt auf politische Einflussnahme.
Sonja Dobkowitz, Autorin der Studie aus der DIW-Abteilung Makroökonomie, empfiehlt strengere Transparenzpflichten für Lobbykontakte sowie weitergehende Offenlegungspflichten, um politische Entscheidungsprozesse resistenter gegenüber wirtschaftlichem Druck zu machen.
Forschung zur Transformation im Fokus
Mit seinen Studien leistet das DIW Berlin einen Beitrag zur fundierten Begleitung der sozial-ökologischen Transformation. Im Mittelpunkt stehen Auswirkungen auf Haushalte, Unternehmen und Märkte sowie Fragen der sozialen Gerechtigkeit und politischen Steuerbarkeit.