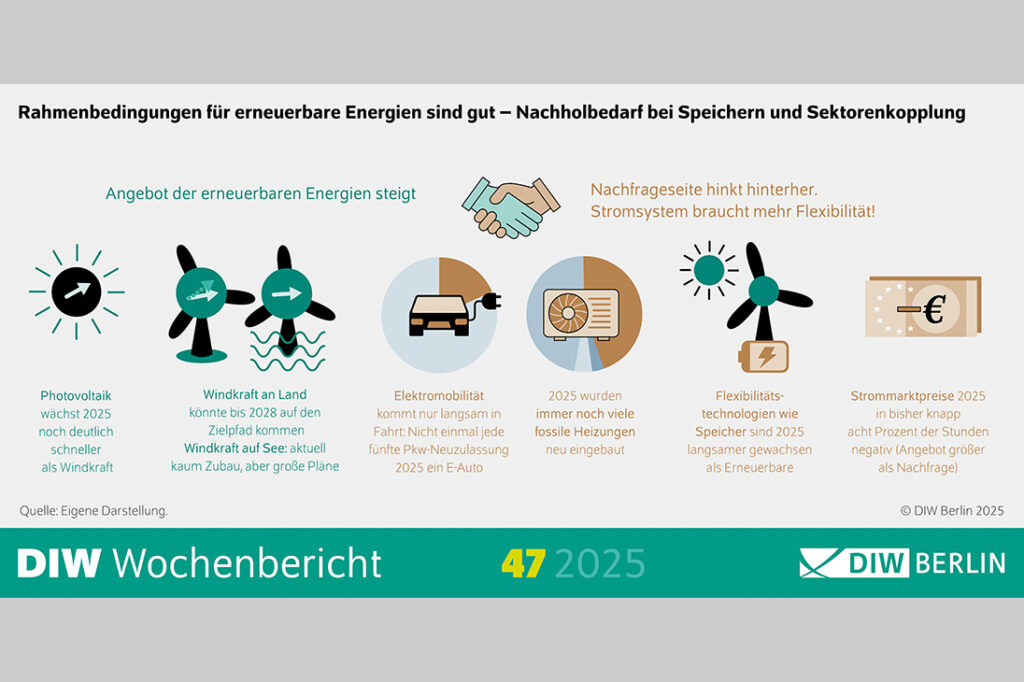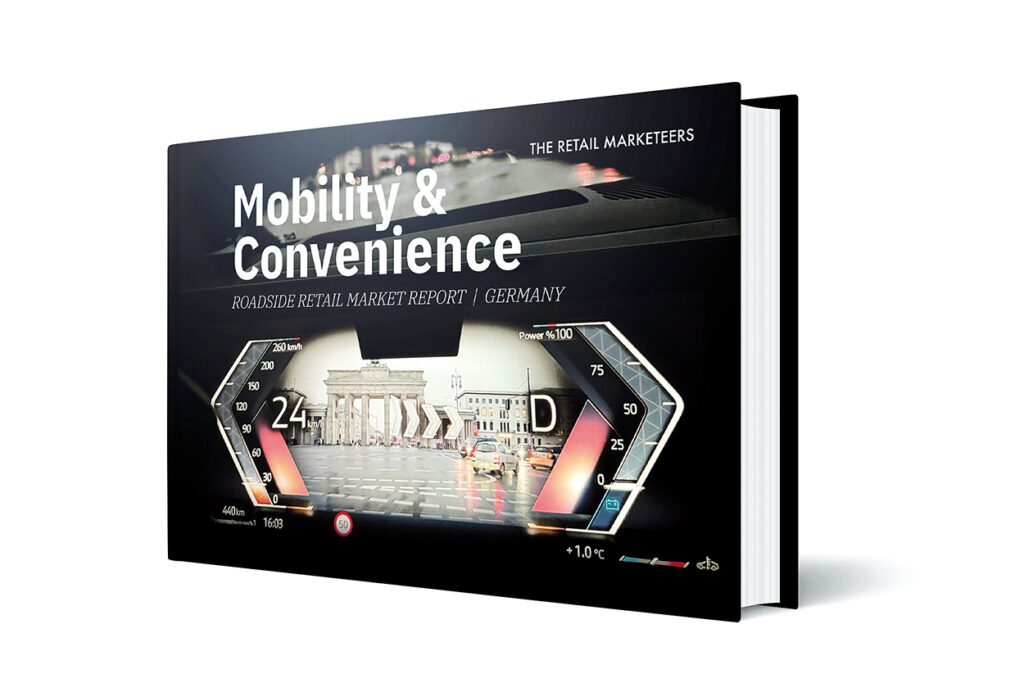Neue Energieverbraucher und Erzeugungsanlagen, wachsender Investitionsbedarf und steigende Anforderungen brauchen neue Lösungen für die Energiewende im Verteilnetz. Die Verteilnetzstudie II der dena Deutsche Energie-Agentur GmbH, Berlin, legt eine betriebswirtschaftlich fokussierte Analyse vor und benennt vier zentrale Handlungsfelder für den zukunftsfähigen Umbau und Ausbau der Verteilnetze: Attraktive Investitionsbedingungen, koordinierte Planung, mehr Digitalisierung und spartenübergreifende Zusammenarbeit zwischen Netzbetreibern.
Corinna Enders, Vorsitzende der Geschäftsführung der dena, betont die Herausforderungen auf dem Weg zur Klimaneutralität im Verteilnetz. Aus ihrer Sicht sind strategische Entscheidungen in der aktuellen Phase entscheidend. Sie fordert einen verlässlichen Ordnungsrahmen, der Investitionen ermöglicht sowie Digitalisierung und Zusammenarbeit auf allen Ebenen unterstützt. Genau an diesen Punkten setzt die aktuelle dena-Studie an.
In der Studie wird ein Muster-Verteilnetzbetreiber einer für Deutschland repräsentativen Kommune modelliert. Die darauf basierende Analyse zeigt mittels betriebswirtschaftlicher Kennzahlen die Auswirkungen des Transformationsverlaufs auf Verteilnetzbetreiber und deren Handlungsmöglichkeiten auf.
Die Studie entstand unter Federführung der dena, in Kooperation mit der BET Consulting GmbH, der Bergischen Universität Wuppertal, der BMU Energy Consulting GmbH sowie 26 Verteilnetzbetreibern. Sie setzt auf bestehenden Energiesystemstudien auf und ergänzt diese um eine betriebswirtschaftliche Perspektive auf die Transformation.
Vier zentrale Handlungsfelder für Politik und Wirtschaft
Die dena hat mit der Verteilnetzstudie II eine umfassende Analyse vorgelegt, wie Verteilnetze bis 2045 klimaneutral umgebaut werden können. Zentrale Erkenntnis: Die Transformation erfordert tiefgreifende strukturelle, regulatorische und finanzielle Veränderungen. Im Mittelpunkt steht die Finanzierung als entscheidender Hebel für den Umbau.
Finanzierung als Schlüssel zur Transformation
Die Studie zeigt, dass der Finanzierungsbedarf massiv ansteigt. Beim untersuchten Muster-Verteilnetzbetreiber erhöhen sich die durchschnittlichen jährlichen Investitionen im Vergleich zu 2024 bis zum Jahr 2045 spartenübergreifend um 85 % bis 123 %. Neben klassischen Fremdmitteln benötigen die Unternehmen zusätzliches Eigenkapital – ein Engpass, der sich insbesondere bei hoher Investitionstätigkeit verschärfen kann.
Zur Deckung dieses Kapitalbedarfs identifiziert die Studie verschiedene Lösungsansätze: eine Anhebung des regulierten Eigenkapitalzinssatzes, die Bereitstellung strategischen staatlichen Eigenkapitals oder die Gründung externer Finanzierungsgesellschaften.
Bessere Planung durch Koordination und Standardisierung
Als zweites Handlungsfeld benennt die Studie die Notwendigkeit einer frühzeitigen und spartenübergreifend koordinierten Infrastrukturplanung. Um ineffiziente Parallelstrukturen zu vermeiden, müssten Stromnetz- und Wärmeplanung zu einer gemeinsamen Energieleitplanung weiterentwickelt werden – basierend auf einheitlichen Datenstandards. Die Vereinfachung und Digitalisierung von Genehmigungsverfahren auf EU-, Bundes- und Länderebene gilt als weiterer Schlüssel zur Beschleunigung des Ausbaus.
Digitalisierung als Effizienztreiber
Die digitale Transformation wird als drittes Handlungsfeld hervorgehoben. Durch intelligente Messsysteme und Echtzeitdaten lassen sich Netzzustand und Auslastung präziser erfassen, Prozesse effizienter gestalten und Versorgungssicherheit erhöhen. Eine digitale Datenbasis verbessert die Prognosefähigkeit, steigert die Netzflexibilität und reduziert den notwendigen Ausbau. Die Studie empfiehlt, dauerhafte Flexibilitätsnutzung ohne unmittelbare Ausbauverpflichtung zu ermöglichen und die Digitalisierungskosten regulatorisch anzuerkennen.
Energiewende als Gemeinschaftsaufgabe
Das vierte Handlungsfeld betont die Kooperation aller Akteure auf kommunaler, regionaler und nationaler Ebene. Eine stärkere Zusammenarbeit der Verteilnetzbetreiber – sowohl zwischen den Sparten als auch mit externen Partnern wie Hochschulen, Start-ups oder regionalen Zusammenschlüssen – wird als notwendig beschrieben, um Ressourcenengpässe und Fachkräftemangel zu begegnen. Auch Kompetenznetzwerke und Joint Ventures können laut Studie einen Beitrag zur Beschleunigung der Transformation leisten.